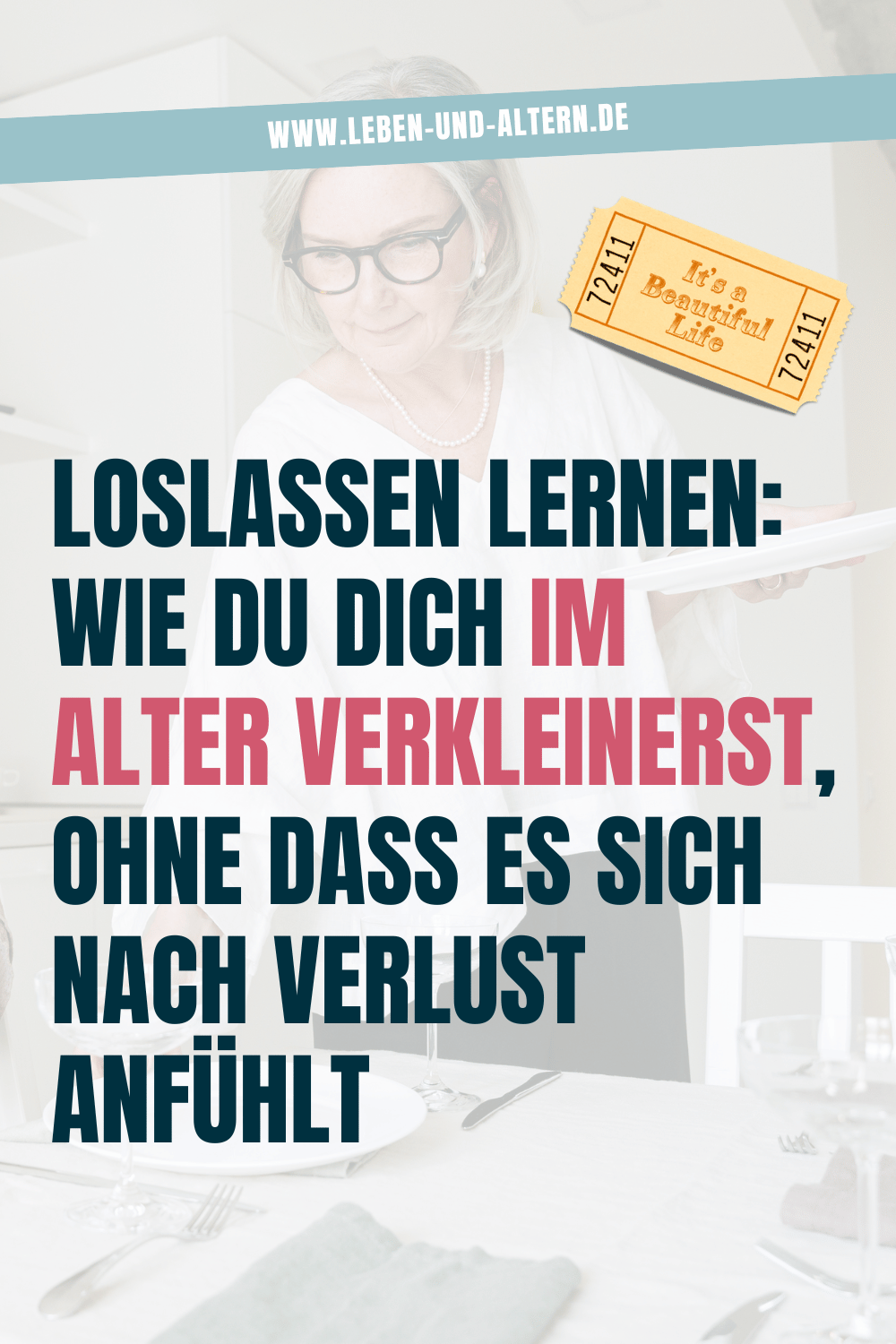Zwei Drittel aller Menschen über 60 haben eine starke emotionale Bindung an bestimmte Gegenstände – das zeigt die Forschung ziemlich eindeutig. Und ehrlich gesagt überrascht das niemanden. Was dagegen überrascht: Wer sein Wohnumfeld im Alter bewusst anpasst, bleibt länger selbstständig und fühlt sich dabei zufriedener.
Ich hab mich im Studium der Integrativen Gerontologie viel mit dieser Frage beschäftigt – wie wir so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause leben können, und was uns dabei eigentlich im Weg steht. Und was man in der Forschung dazu liest, deckt sich mit dem, was viele Menschen über 60 beschreiben, wenn es ums Thema Downsizing geht: Der Kopf weiß längst, dass die Wohnung zu groß geworden ist. Das Bauchgefühl sagt trotzdem: Wenn ich mich verkleinere, gebe ich auf.
Warum das so ist, was die Psychologie dazu sagt, und wie ein Wohnungswechsel im besten Fall nicht nach Verlust klingt, sondern nach Entscheidung – darum geht es hier.
Warum klingt Downsizing nach weniger – obwohl es mehr sein kann?
Schon das Wort ist ein Problem. Downsizing bedeutet wörtlich: verkleinern, reduzieren, weniger. Kein Mensch wacht morgens auf und denkt sich: heute hätte ich gern weniger. Das steckt tief drin.
Dabei zeigt die Forschung etwas anderes. Menschen über 55, die ihr Wohnumfeld bewusst an die aktuelle Lebensphase anpassen, bleiben im Schnitt länger selbstständig – und berichten von mehr Zufriedenheit. Das hat mich damals im Studium ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Ich hätte erwartet, dass die meisten das als Verlust erleben. Tatsächlich ist es oft umgekehrt.
Der Unterschied liegt darin, wann die Entscheidung fällt. Wer selbst entscheidet, bevor irgendjemand anderes entscheiden muss, behält die Kontrolle. Wer wartet, bis die Treppen zu beschwerlich werden oder die Nebenkosten außer Hand geraten, reagiert nur noch. Das ist ein ziemlich großer Unterschied – für das Gefühl und für das, was danach kommt.
Viele Menschen, die sich verkleinert haben, sagen im Rückblick dasselbe: „Ich hab nicht erwartet, dass es sich so leicht anfühlt.“ Die Vorstellung war schlimmer als die Realität. Was bleibt, ist kein Verlust. Es ist Platz.
Was haben meine Sachen eigentlich mit meiner Identität zu tun?
Ziemlich viel, um ehrlich zu sein. In der Psychologie gibt es den sogenannten Besitztumseffekt: Dinge, die uns gehören, erscheinen uns automatisch wertvoller – einfach deshalb, weil sie uns gehören. Die kaputte Stehlampe im Keller? Die könnte man morgen für zwei Euro auf dem Flohmarkt kaufen. Aber weil sie einem gehört, fühlt sie sich unbezahlbar an. Das bildet man sich nicht ein, das ist Neurobiologie.
Und das erklärt, warum das Loslassen so schwer fällt. Der Stuhl, in dem man das Kind gestillt hat. Die Bücher, die durch schwere Zeiten begleitet haben. Das Geschirr von der Hochzeit. Das sind keine Gegenstände, das sind Kapitel. Wenn man sie weggibt, fühlt es sich an, als würde man ein Stück von sich selbst hergeben – nicht das Ding fehlt dann, sondern das, wofür es steht.
Der Schmerz hängt aber nicht am Gegenstand. Er hängt an der Erinnerung. Und die Erinnerung darf man behalten.
Unsere Gegenstände erzählen unsere Geschichte – aber sie sind nicht unsere Geschichte. Das ist ein Unterschied, der sich mit etwas Abstand tatsächlich verändert. Was bleibt, wenn die Kartons weg sind, ist nicht Vergessen. Es ist Klarheit. Wer sich fragt, was Alter überhaupt mit der eigenen Identität macht, findet dazu mehr in meinem Beitrag ab wann ist man eigentlich alt.
Was mache ich mit Dingen, an denen Erinnerungen hängen?
Drei US-Forscherinnen haben etwas herausgefunden, das beim ersten Lesen fast zu simpel klingt: einfach fotografieren, bevor man etwas weggibt. Das war’s. Die Versuchspersonen, die das gemacht haben, haben deutlich mehr losgelassen als die Kontrollgruppe. Das Foto wird zur Erinnerungsstütze – und das Ding darf weiterziehen. So wenig, und trotzdem so wirksam. Ich finde das faszinierend.
Ein weiterer Ansatz, den viele Menschen über 60 als hilfreich beschreiben: eine kleine Holzkiste – nicht größer als ein Schuhkarton. Darin landet, was wirklich etwas bedeutet. Ein Ring der Mutter. Ein Brief. Ein kleines Spielzeug der Kinder. Der Rest wird fotografiert und darf gehen.
Dazu passt auch der Gedanke einer festen Ecke zu Hause, die nur für Erinnerungen gedacht ist – ein paar Fotos, ein Gegenstand, der Geschichten erzählt, eine Kerze. Nichts Großes. Aber ein Platz, der verbindet mit dem, was war, ohne am Weitergehen zu hindern.
Und noch etwas, das hilft: Dinge, die man weitergibt, hören nicht auf zu existieren. Die Nähmaschine der Großmutter bei der Tochter ist immer noch die Nähmaschine der Großmutter. Sie gehört jetzt halt zur Familie, nicht mehr nur zum eigenen Keller.
Wie fange ich an, wenn ich gar nicht weiß, wo?
Nicht im Schlafzimmer. Und auf keinen Fall mit den Fotoalben. Das ist die häufigste Falle beim Downsizing über 60: Man fängt an den Stellen an, die emotional am aufgeladensten sind, und kommt nach zwei Stunden zu gar keinem Ergebnis – außer einem ziemlich schlechten Gefühl.
Sinnvoller ist es, dort anzufangen, wo am wenigsten Erinnerungen hängen: der Keller, die Abstellkammer, das Zimmer, das seit Jahren als Sammelstelle für alles dient, was sonst keinen Platz hat. Ein einfaches System, das sich dabei bewährt hat, arbeitet mit vier Kisten:
- Behalten – was wirklich noch genutzt wird oder wirklich am Herzen liegt
- Verschenken – was noch gut ist und jemandem Freude machen kann: Kinder, Enkel, Nachbarn, Sozialkaufhäuser
- Verkaufen – was noch Wert hat, über Kleinanzeigen, Flohmärkte oder Second-Hand-Läden
- Entsorgen – was kaputt ist oder niemand mehr braucht
Das Tempo bestimmt man selbst. Ein Zimmer pro Monat reicht. Eine Schublade pro Woche auch. Es gibt keine Vorschrift, dass das an einem Wochenende erledigt sein muss – und der Versuch, es trotzdem zu erzwingen, macht es meistens schwerer, nicht leichter.
Wer Menschen einbezieht, macht es sich nicht nur leichter, sondern oft auch schöner. Die Tochter freut sich vielleicht über die Nähmaschine. Der Nachbar hätte gern den Werkzeugkasten. Ein gemeinsamer Nachmittag im Keller kann erstaunlich gut werden, wenn man es zulässt. Für größere Möbel holen viele Sozialkaufhäuser direkt ab – das nimmt noch mal eine Hürde weg.
Und was mache ich mit den leeren Räumen?
Das ist der Teil, der mich am meisten interessiert. Weil er zeigt, dass Verkleinern kein Ende ist, sondern ein Anfang.
Ein leerer Raum gehört einem. Was wollte man schon immer? Ein Zimmer nur zum Lesen, Nähen, Malen? Einen kleinen Fitnessraum, damit man morgens nicht mehr ins Studio fahren muss? Eine Werkstatt? Ein Gästezimmer für die Enkel, wenn sie übers Wochenende kommen?
Oder ganz pragmatisch: einfach ein Zimmer weniger heizen. Fenster zu, Heizung runter, Tür schließen. Das spart je nach Wohnungsgröße schnell 200 bis 400 Euro im Jahr. Bei den aktuellen Nebenkosten ist das kein Pappenstiel.
Die Forschung zeigt dazu etwas Interessantes: Menschen über 60, die ihre Wohnung aktiv an ihre Bedürfnisse anpassen, fühlen sich handlungsfähiger – sie warten nicht, bis sich etwas ändern muss, sondern entscheiden vorher. Ob die Wohnung 120 Quadratmeter hat oder 65, ist dabei tatsächlich egal. Was zählt, ist, dass sie sich wie ein Zuhause anfühlt – für die Person, die man heute ist.
Wird es besser – oder fehlt einem irgendwann alles?
Viele Menschen, die sich verkleinert haben, sagen im Rückblick: „Die Vorstellung war schlimmer als die Realität.“ Und dann noch: „Ich vermisse die Dinge nicht. Ich vermisse das Gefühl, das ich mit ihnen verbunden habe. Aber das Gefühl ist ja noch da.“
Was dabei im Körper passiert, ist übrigens real: Unser Gehirn schüttet Stresshormone aus, wenn wir loslassen – ähnlich wie bei einem sozialen Verlust. Das bildet man sich nicht ein. Aber es geht vorbei. Es ist wichtig zu wissen, dass es normal ist, wenn es sich am Anfang nicht gut anfühlt. Das heißt nicht, dass die Entscheidung falsch war.
Was bleibt? Weniger putzen, weniger suchen, weniger Chaos. Mehr Platz – nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Kopf. Das klingt vielleicht nach Kalenderspruch. Stimmt trotzdem.
Wie schaffe ich es, dass sich Verkleinern nicht nach Aufgeben anfühlt?
Indem man aufhört, es Rückschritt zu nennen.
Man räumt auf – für sich selbst, für die nächsten zwanzig Jahre. Man stellt das eigene Zuhause so auf, dass es zur Person passt, die man heute ist. Nicht zu der, die man vor dreißig Jahren war.
Erinnerungen existieren in einem – nicht im Karton im Keller. Was einen ausmacht, passt nicht in Umzugskisten. Und eine Wohnung, die man selbst in Ordnung halten kann, gibt einem länger Unabhängigkeit. Das ist keine Einschränkung. Das ist Selbstbestimmung.
Wer tiefer ins Thema einsteigen möchte: Ich habe schon früh mal aufgeschrieben, wie altersgerechtes Wohnen und Downsizing praktisch funktioniert – mit konkreten Schritten. Und wer auf der Suche nach Lesestoff ist, der das Thema Loslassen und neue Lebensphasen noch mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet: in meinen Buchempfehlungen übers Älterwerden ist einiges dabei, das gut dazu passt.
Loslassen ist kein einmaliger Akt. Manchmal dauert es Wochen, manchmal Monate. Manchmal packt man einen Karton aus, drückt ein altes Foto an die Brust und stellt ihn wieder zurück. Geschenkt. Aber irgendwann geht man durch die Wohnung und merkt: hier ist Platz. Nicht Leere. Platz. Für das, was jetzt kommt.
Genieß dein Leben. Du hast nur eins.
Marlis